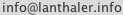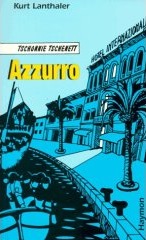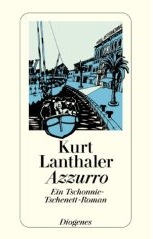Azzurro
Roman.
Haymon Verlag, 1998. Diogenes Taschenbuch, 2001
Was ist schon Schwimmen? Keine
Kunst! Ertrinken!
(An A.T., aus Ouranopoli)
Kapitel I
Uarda lu mari comu si sta confia,
sta rriva
la burrascka
Die Uranus lief bei schwerer See und Windstärke Zehn aus Nordwest einen
Westkurs auf Grönland, als ich über Bord ging.
Eben
hatte ich noch das Fanggeschirr festgezurrt. Wir wären es sonst
innerhalb der nächsten Minuten losgeworden. Ich war froh, gleich wieder
unter Deck gehen zu können, als mich ein Brecher von den Füßen holte.
Ich
fiel, und im Fallen schrie ich um Hilfe. Zum ersten Mal in meinem Leben
und deshalb so laut wie nie zuvor und in der Hoffnung, daß von dem
Glück, das einem fürs Leben zugeteilt ist, noch ein möglichst großer
Rest geblieben war.
Als ich auf das Wasser schlug und die schwarze
See sich über mir schloß, war es urplötzlich still um mich herum. Kein
pfeifender Wind mehr, keine tosenden Brecher, kein Ächzen von Metall
und kein Stampfen der Maschine. Stille. Dann ein leises Rauschen in
meinem Kopf. Wenn, dachte ich, wenn da keiner ist, sobald du
auftauchst, wenn da kein Rettungsring ist, keine Leine, wenn keiner
dich bemerkt hat, wenn niemand dich vermißt, dann sei froh, daß du
niemals richtig schwimmen konntest. Und halt dich an die alte
Seemannsregel. Lieber sofort absaufen und runtergehen wie ein Stein,
als Stunden später jämmerlich erfrieren.
Aber ganz konnte ich das
Leben doch nicht lassen. Also ließ ich mich mit emporreißen, schoß aus
dem Wasser, holte hustend Luft und öffnete die Augen. Ich sah den
Wasserberg vor mir und mir kamen andere Berge in den Sinn, Jahre, daß
ich sie nicht mehr gesehen hatte, glaubte dann einen roten Fleck
entdeckt zu haben, irgendwo. Rot, das mußte Rettung sein. Eine
Schwimmweste, ein Rettungsreifen. Aber der zweite Blick, der dritte,
vierte, konnte kein Rot mehr finden, links nicht, vorneaus nicht,
nirgendwo. Schwarz das Wasser, grau die Luft. Ich hatte mich geirrt.
Und schluckte wieder Wasser. Da stieg die Uranus vor mir auf und rollte
über. Und als ich schreien wollte, hörte ich den Schrei.
Es war
nicht meiner. Ich redete mir ein: Das ist nicht deiner, das warst du
nicht, nicht du. Da ist wer andrer. Nur war da keiner. Da war nur ich.
Und Wasser. Und das Meer. Mehr nicht. Und wieder lag ich in dem tiefen
Tal und ringsherum nur Wellen, hohe See. Ich nahm ein maulvoll Wasser.
Und... :, dachte ich, adieu.
Kapitel X
Aber im entscheidenden Augenblick
Verlassen
uns Kühnheit und Entschlossenheit
(Konstantinos
Kavafis)
(...)
Ich war so lange durch die Gassen am Hafen gelaufen, bis es hell
geworden war. Es wurde nichts besser dadurch, nur sichtbarer.
Trieste
war früher einmal vielleicht ein großer Hafen gewesen. Viel war davon
nicht mehr übrig. Ein paar verwaschene Aufschriften, Schrotthalden,
abgewrackte Kähne. Dazwischen Touristen-Abwickel-Anlagen. Und die
verzweifelten, EU-geförderten Bemühungen, das alles anders zu machen.
Es wurde Zeit für meinen Frühstücks-Espresso.
(...)
Mit jedem
Schritt, mit dem ich dem Schrott, hinter denen ich die Linee Adriatiche
finden sollte, näher kam, mit jedem Schritt verstand ich den Alten
besser. Und gab, zumindest hier und heute, meiner seefahrerischen
Zukunft laufend weniger Chancen.
Als ich endlich vor der wackeligen
Baracke stand, an der hochkant ein Schild lehnte, auf dem man mit viel
gutem Willen driatiche entziffern konnte, klopfte ich nur noch an, um
zu sehen, wie der Alte Recht behalten würde.
Die Tür war nur angelehnt. Sie schwang quietschend auf, von innen war
so etwas wie ein Brummen zu hören. Ich trat ein.
Hinter
einem von Pizzakartons, Bierdosen und Papieren überquellenden Tisch in
der Mitte der dunklen Baracke saß ein Mann, der versuchte, etwas
Ordnung in seine querstehenden Haare zu bekommen.
Er sah mir ganz
danach aus, als ob er bis eben, in der Rechten die Ginflasche, Kopf auf
der Tischplatte, im Sitzen geschlafen hätte. Ein junger Mann, der die
letzten zwei Jahre fünfzehn Kilo zugenommen hatte. Graue Tränensäcke,
das leichte Rot einer anständigen Menge Restalkohols auf den Wangen und
das zitternde Verlangen in seinen Fingern. Ein junger Mann, der seine
Zukunft schon so weit hinter sich hatte, daß es sinnlos war, sich
danach umzudrehen. Und man sah ihm an, daß er das wußte.
Genauso,
wie ich meinen Seesack darauf verwettet hätte, daß das telefonino, das
in Italien Telefönchen genannte Funktelefon, das auf den Resten einer
pizza diavola trohnte, schon seit ewigen Zeiten gesperrt war.
„Buon
giorno", sagte ich, zog mir, neugierig geworden, einen Stuhl von der
Wand an den Tisch, stellte meinen Seesack ab und setzte mich.
Während
ich abwartete, daß sich der junge Mann langsam und ächzend zu den
Resten seines Bewußtseins durchkämpfte, sah ich mich um. Und sah die
Überbleibsel vergangener Herrlichkeit. Das Schwarzweißbildnis eines
energisch von der Wand auf das Desaster blickenden Herren, in dem ich
ein Abbild des Signor Bentivoglio vermutete. Technicolorfarbene
Plakate, auf denen stolze Schiffe prangten. Und stolzer noch, darüber,
der weich geschwungene Schriftzug: Linee Adriatiche. Società Anonima di
Navigazione. Trieste. Linee Italiane per Tutto il Mondo. Es hatte sie
also wirklich gegeben. Vor ewigen Zeiten. Die Anonyme
Seefahrtsgesellschaft. Die für und in die Ganze Welt fuhr.
Tempi
passati, wie der Italiener zu sagen pflegt. Und wenn er das sagt, tut
er es meist mit einem kaum unglücklich zu nennenden Achselzucken. Was
vorbei ist, kann keinen Ärger mehr machen.
Dann war der junge Mann
endlich bei sich angekommen, raffte sich, Unverständliches von sich
gebend, auf, stützte sich an der Tischkante ab und stemmte sich hoch.
„Buon giorno", sagte ich, „cercavo il signor Bentivoglio e le Linee
Adriatiche."
Sich immer noch an der Tischkante abstützend, versuchte der junge Mann
zu verstehen, was ich gesagt hatte.
Dabei
war das einfach. Ich hatte ihm freundlich einen guten Morgen gewünscht
und erklärt, nach dem Herren Bentivoglio und seinen Linee Adriatiche zu
suchen.
„Ich", sagte der junge Mann da, plötzlich laut aus sich herausbrechend,
„ich bin Signor Bentivoglio."
Er hatte es sogar gewagt, eine Hand vom Tisch zunehmen und einen großen
Bogen durch die Luft zu ziehen damit.
„Sehr schön", sagte ich. „Gibt es hier noch einen anderen Signor
Bentivoglio?"
Mir wollte es nicht in den Kopf, daß die beiden ewigen Verlobten mich
an dieses Wrack weiterreichen gewollt hatten.
„No",
sagte der junge Mann, griff umstandshalber mit einer halb panisch, halb
fahrigen Bewegung wieder nach dem Schreibtisch, der daraufhin leicht in
Bewegung geriet, für Bruchteile einer Sekunde nur, aber lange genug,
damit sich Angst in seinem Gesicht breitmachte.
„Sie sind jung", sagte ich.
„Ja",
sagte er. „Was nur heißt, daß ich nicht bescheißen kann. Um seinen
eigenen Sohn bescheißen zu können, und das ist die Krönung von Beschiß,
wie Sie vielleicht wissen, muß man ein alter, geiler Bock sein. So
einer wie der vecchio signor Bentivoglio."
Ich sagte nichts.
„Sie haben ihn gekannt?" sagte er, und einen Augenblick lang waren
seine Augen wach geworden.
„Ich? Nein. Leider. Ihrer Beschreibung nach muß er ein interessanter
Mensch sein."
Der junge Mann ließ etwa einen halben Liter Luft ab, pfeifend über die
Schneidezähne.
„Ja. Das sieht die ganze Welt so. Nur ich kann das nicht so sehen."
„Er wurde mir in Vicenza von Freunden empfohlen. Zusammen mit seinem
Betrieb", sagte ich. „Ich bin ..."
Und ich zeigte auf meinen Seesack, der an der Tür lehnte.
„Freunde?" sagte der junge Mann.
„Ältere Herrschaften. Ich glaube, die Dame stammte ursprünglich aus
Trieste. Oder hat hier gelebt. Vor dem Krieg."
„Goldene Zeiten", sagte der junge Mann, „sehen Sie sich um. Da hängt,
was davon noch übrig ist."
Und
damit löste er sich vom Tisch, schüttelte den Kopf und ging, plötzlich
mit einer bemerkenswerten Körperbeherrschung, auf die Wand zu, riß das
Bild seines alten Herren von der Wand, ging an die Barackentür, öffnete
sie und warf das Bild hinaus. Dann drehte er sich wieder zu mir um.
„Ich
hätte es früher tun sollen", sagte er, „vor zehn Jahren. Aber das wird
Ihnen ziemlich gleichgültig sein. Entschuldigen Sie."
Er machte sich wieder auf den Weg zurück an den Tisch.
Hielt
mitten im Schritt inne, drehte sich nach links, ging an die Seitenwand
der Baracke, griff nach den Plakaten der Linee Adriatiche und zerriß
sie in kleine Streifen.
„Ecco", sagte er, „das war’s. Das waren die berühmten Linee Adriatiche."
Er
ließ sich erschöpft auf seinen Stuhl fallen, einen Augenblick lang
fürchtete ich um dessen Statik, dann griff er nach seinem
Krawattenknopf und richtete ihn aus, äußerst penibel und wie mit dem
Lot, zupfte an Hemd, Hose und Jacket, polierte die Manschettenknöpfe,
und klemmte ein Büschel widerspenstiger Haare hinter sein Ohr. Bohrte
sich langsam mit beiden Armen in geradem Weg nach vorne durch die Berge
auf seinem Schreibtisch, atmete kurz ein, und fegte mit dem linken Arm
links und mit dem rechten Arm rechts alles zu Boden, was sich in
Jahrhunderten vor ihm angesammelt hatte.
„So", sagte er dann, zog die Hemdärmel mit spitzen Fingern wieder an
ihren Platz, „was können wir für Sie tun?"
„Ich bin Seemann und wollte bei Ihnen anheuern", sagte ich.
„Eigentlich. Ursprünglich."
Er streckte das linke Handgelenk nach vorne, lange genug, um einen
kurzen Blick auf seine Armbanduhr zu werfen.
„Vediamo", sagte er, „lassen Sie uns sehen, was wir da haben."
Lehnte sich zurück in den Stuhl, hob den Kopf zur Barackendecke und
dachte nach.
„Bene", sagte er.
Und sagte nichts weiter.
Ich wartete ab.
„Seemann ...", sagte er, „was haben wir da?"
Ich hielt den Atem an. Besser, ihn bei seinen nach oben gewandten
Betrachtungen nicht zu stören.
„Ein Schiff?" sagte er.
Nur weil er den Blick wieder in die Waagrechte genommen hatte, traute
ich mich, ihm zu antworten.
„Ein Schiff für einen Seemann", sagte ich, „das wär nicht schlecht."
„Ein
Schiff ...", sagte er, und ich hatte den überdeutlichen Eindruck, daß
er mich nicht gehört hatte, „naja, vielleicht läßt sich da etwas
machen."
Ich versuchte es probeweise damit, aufzustehen und nach meinem Seesack
zu greifen.
„Setzen Sie sich!" schrie er mich an. „Setzen!"
Ich tat wie befohlen.
Und dann lachte er los. Langsam erst und leise, dann immer gewaltiger
und atemloser.
Laß ihm Zeit, Tschenett, dachte ich. Du hast es ja nicht eilig.
„Sie
sehen ja, was hier los ist", sagte er dann, nachdem er wieder zur Ruhe
gekommen war, mit einer Stimme, die daherkam, als würde sie die
amtlichen Lottozahlen durchgeben.
„Ich weiß nicht, was ich sehen soll", sagte ich.
„Die
Reste einer Reederei", sagte er, und ich fragte mich, wo er mit einem
Mal die Ruhe in seinen Worten hernahm. „Die Reste. Und in ein paar
Stunden werden auch die verschwunden sein. Außer ich bestehe darauf,
weiterhin in dieser Baracke zu wohnen. Man würde es mir erlauben,
glauben Sie mir."
Ich nickte.
„Es regnet durch."
„Keine guten Voraussetzungen, um eine Familie zu gründen und sich zu
vermehren", sagte ich.
„Linee
Adriatiche war eine große Sache. Als Kind wurde ich in einen
Matrosenanzug gesteckt und hielt die Hand meiner Mutter, als sie die
Novara II taufte. Mein Vater hatte sich für diesen Tag einen Schnauzer
wachsen lassen und ihn wochenlang verborgen vor seiner Umgebung. Ein
majestätisches Schiff, unsere Novara II. Und ein großer Name. Sie
kennen die Geschichte?"
„Leider nein."
„Die ursprüngliche Novara
war das Schiff, das Maximilian und Charlotte nach Veracruz brachte und
Maximilians Leiche nach Trieste. Als Kind liebte ich diese Geschichten.
Inzwischen liegt die Novara II seit über zehn Jahren in irgendeinem
indischen Hafen und wird verschrottet."
Er zog die Schublade auf, holte ein Stück Papier und einen Bleistift
heraus.
„Fünf
Schiffe hat er in sieben Jahren verschrotten lassen. Macht Millionen
Lire für den Schrott und Milliarden Stillegungsprämien von der EG. Vor
vier Monaten sagte er, er wolle vererben. Eines von zwei Konten in der
Schweiz, Mutters Villa in den colline und die Reederei. Als ich die
Papiere in der Hand hatte und er abgereist war, irgendwohin, stellte
ich fest, daß die Kontoauszüge gefälscht und die Villa längst
verpfändet war. Mir blieb die Reederei. Ich suchte sie also ..."
„Ich weiß", sagte ich, „ist gar nicht so einfach zu finden."
„...
und stellte fest, daß von meinem Erbe diese Baracke und ein Frachter
geblieben war. Die Splendor. Sie hatte ihm zu Zeiten des
Jugoslavienkrieges Hunderte von Millionen eingefahren. Sie zahlen jeden
Charterpreis, sagte er, Waffen- und Treibstoffschmuggel. Und natürlich
die Wohltätigkeitsorganisationen. Wie verrückt. Die Splendor war mir
also noch geblieben. Ohne Krieg zwar in der näheren Umgebung und damit
nur halb soviel wert, aber immerhin. Für ein oder zwei Jahre sollte es
reichen, die EG würde dafür sorgen. Ich habe alle Papiere ausgefüllt
und einem Abgeordneten, den ich vom Yachthafen her kenne, einen schönen
Urlaub bezahlt. Und warte auf die Antwort aus Brüssel. Warte. Und was
muß ich mir vor zwei Tagen sagen lassen?"
„Ich höre."
„Daß ich
eine Mannschaft für die Splendor anzuheuern habe, dafür eine Million
Lire bekomme, und daß die Splendor dann auslaufen wird und auf
Nimmerwiedersehen. Weil Signor Bentivoglio Karten gespielt, verloren
und ein entsprechendes Papier unterschrieben hat. Vor einem Monat. In
Frankfurt."
Schwerer Schicksalsschlag für einen jungen Menschen.
„Ich hoffe, der geile Bock von meinem Vater erstickt an seinem eigenen
Schwanz."
Schwerer Schicksalsschlag, auch für einen älteren Menschen.
„Eine Million Lire sind mir geblieben. Wissen Sie, wieviel das ist?"
sagte er.
„Naja", sagte ich, „ein paar Tage muß der Mensch dafür schon arbeiten.
„Oder zweimal essen gehen", sagte er, „wenn ich meine Gewohnheiten zum
Maßstab nehme."
„Bedauerlich", sagte ich, „daß Ihre schöne Jugend ein so tristes Ende
genommen hat."
„Sie verachten mich, nicht wahr?"
„Mitleid.
Nichts als tief empfundenes Mitleid. Und Sympathie. Verbunden mit der
Frage, ob es denn noch einen Platz auf dieser historischen Ausfahrt
gibt. Und wenn ja, zu welchen Bedingungen."
Der junge Mann und Erbe bückte sich zu Boden, kramte und suchte, und
zog schließlich die Ginflasche an sich.
„Ich hätte vielleicht auch Seemann werden sollen", sagte er.
„Sie haben Mutters Hand gehalten, während sie Schiffe taufte. Solche
Leute nimmt man nicht an Bord. Das bringt Unglück."
Er senkte langsam zweimal den Kopf.
„Trinken
Sie", sagte er dann und hielt mir die Flasche hin, „mit Gläsern,
Zigarren und Frauen kann ich zur Zeit leider nicht dienen."
„Es wird auch so noch ein schöner Tag werden", sagte ich. „Habe ich den
Job?"
„Wenn
Sie wollen", sagte er. „Ich war schon ziemlich verzweifelt. Um an die
Million Lire zu kommen, muß ich eine komplette Mannschaft anheuern.
Nur: es gibt keine Seeleute mehr in dieser Stadt."
Er lächelte, als ich ihm die Flasche rüberschob.
„Außer Ihnen, natürlich. Und vor allem: es gibt keinen, der auf die
Splendid will."
Er
hatte mir zwar eben wieder die Flasche zugeschoben, aber ich war
trotzdem aufmerksam geworden. Das kennst du, Tschenett, dachte ich.
„Warum?" sagte ich.
„Aberglauben, alte Geschichten, was weiß ich. Seemannsgarn."
Ich sah ihn zweifelnd an. Komm schon, Junge.
„Hunderttausend
Lire geb ich Ihnen, wenn Sie anheuern", sagte der junge Mann, „dann
fehlen noch drei, aber die Splendid kann trotzdem auslaufen. Soll nach
Albanien gehen, soviel ich weiß."
„Warum will keiner mit?" sagte ich.
„Keiner
stimmt ja nicht", sagte er, „Käptn, Maschinist und Steuermann sind da,
die Stammbesatzung. Zwei von denen leben seit einem Jahr schon auf dem
Pott."
Sobald er vergebens versuchte, in die Seemannssprache zu verfallen,
wurde er mir unsympathisch.
„Also?"
„Naja", sagte er, „man hält mich für einen ohne coglioni, Sie
verstehen?"
Ich sah ihn stumm und regungslos an.
„Einen Verlierer. Und mit so einem fahren nicht einmal die Slowenen.
Obwohl ich ja gar nicht auf den Kahn gehen will."
„Zu einem Frachter sagen nur Landratten Kahn", sagte ich.
„Das kommt dazu", sagte er. „Was ist, kann ich mit Ihnen rechnen?"
„Wann geht’s los?"
„Heute morgen", sagte er.
Als ich ihn zweifelnd ansah, brachte er seine Armbanduhr wieder zum
Vorschein und sah nach.
„Naja, spätestens mittags."
„In einer Stunde also."
"Oder nachmittags. Ich weiß es nicht."
„Gut",
sagte ich, griff mir die Ginflasche und setzte sie an, „eine Stunde
kann ich noch sitzen bleiben. Höchstens zwei. Dann wird mich wieder das
Reisefieber packen."
„Das heißt, sie tun den Job?"
„Nein", sagte ich, „das heißt, daß ich eben angeheuert habe. Auch
wenn’s nicht ganz geheuer ist."
Er lachte.
„Ha
ha", sagte ich und stand auf. „In ihrem Lachen klingt zuviel Angst mit.
Man kann sie hören. Und riechen. Aber das soll nicht meine Sorge sein.
Das Geld ..."
„Sie sind dabei?"
„Das Geld."
Quäl ihn nicht zu sehr, Tschenett, er hat wirklich Schiß.
Wird schon sein. Sonderlich sympatisch ist er auch nicht.
Nur weil du die Leiden Kinder reicher Eltern nicht verstehst.
„Sehen
Sie", sagte ich, als er mir endlich, nach langem Hin und Her in den
Taschen seinen Jackets und den Schubladen seines Tisches den Schein
entgegenhielt, „sehen Sie, es ist vielleicht mehr mein Problem als
Ihres. Aber die Kinder reicher Eltern sind mir ein Greuel."
„Auch wenn man sie um ihr Erbe betrogen hat?"
Ich sah kurz in sein in Alkohol und Selbstmitleid zerfließendes Gesicht.
„Besonders dann", sagte ich, drehte mich um und ging dem Ausgang zu.
„Und wissen Sie wieso?"
„Sagen Sie es mir."
Seine Stimme war schwach und schwächer geworden, er hielt mir seine
Kehle hin und bat um den Biß.
„Weil ich verstehen kann, daß sie leiden." Ich griff mir den Seesack.
„Und weil mit meinem Verständnis gerechnet wird."
„Ich brauche noch eine Quittung", sagte er und reckte mir ein Formular
hinterher.
"Wo liegt die Splendid?"
Es reichte.
„Backbord."
„Wo?"
Ein falsches Wort noch und ich zünde dir die Bude unterm Hintern an.
„Vier-, fünfhundert Meter links."
„Ich melde mich beim Alten", sagte ich und ging los.
Wenn
die Splendid auch nur halb so sehr heruntergekommen war wie der junge
Mann, von dem ich mich hatte anheuern lassen, dann war ich jetzt auf
dem Weg zu einem Seelenverkäufer.
Dreißig Schritte weit war ich gekommen, als ich ihn hinter mir wieder
klagen hörte.
„Nehmen Sie mich mit", rief er, „bringen Sie mir die Seefahrt bei. Ich
bezahle Sie dafür."
Ich
drehte mich um. Einen letzten Blick hatte er vielleicht doch verdient.
Weil wir alle uns einen letzten Blick verdient haben. Nur dafür, daß
wir versuchen, zu überleben. Wie elend auch immer.
„Das kann nicht beigebracht werden und bezahlt schon gar nicht."
„Was dann?"
„Man muß es haben. Dann kann es einem auch keiner nehmen."
Jeder von uns hat ein klares Wort verdient. Einmal im Leben.
(...)
Alle
hier veröffentlichten Texte unterliegen dem Urheberrecht.
Sie stehen den Nutzern allein zu persönlichen Zwecken zur
Verfügung.
Jede darüberhinausgehende Verwertung bedarf der vorherigen
Zustimmung des Autors.
Alle hier nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte bleiben
vorbehalten.
© Copyright der Texte: Haymon Verlag, Diogenes Verlag und
Kurt Lanthaler
Gewerblicher Gebrauch nur nach Anfrage beim Autor und
Genehmigung des Verlages